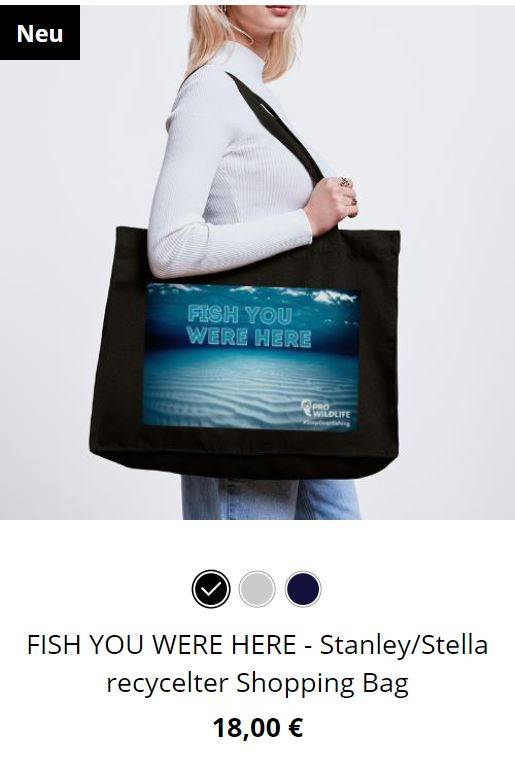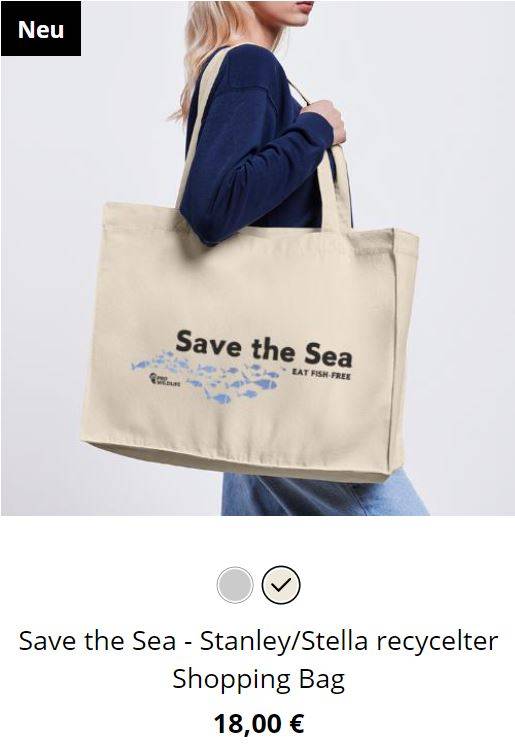Inhaltsverzeichnis:
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu essen, um die Aufnahme wichtiger Nährstoffe (wie Omega-3-Fettsäuren) zu sichern. Allerdings gelangen Schadstoffe über verschiedene Wege in Gewässer und damit auch in Speisefische. Vor allem Schwermetalle, Mikroplastik und Giftstoffe spielen eine Rolle. Wie gesund ist der Verzehr von Fisch und Muscheln tatsächlich?
Schwermetalle und Giftstoffe
Schadstoffe wie Cadmium, Quecksilber oder PFAS sind giftig für den Körper. Diese Schwermetalle und Giftstoffe können von Pflanzen oder Tieren aus der Umwelt aufgenommen werden und so in die Nahrungskette gelangen.
Quecksilber
Quecksilber (Hg) ist ein weit verbreiteter Schadstoff, der vor allem durch Bergbau und Kohleverbrennung in die Umwelt gelangt, ins Meer eingetragen und dort in Methylquecksilber (MeHg) umgewandelt werden kann. Dieses organisch gebundene Quecksilber kommt vorwiegend in Fischen und Muscheln vor – unsere Hauptquelle für die Aufnahme von Quecksilber über Lebensmittel.
Die Konzentration von Schadstoffen in Fischen hängt vom jeweiligen Fanggebiet, von Art und Alter der Fische ab. Insbesondere bei großen, alten Raubfischen wie Haien, Thun- und Schwertfischen, die am Ende der Nahrungskette stehen, kann es infolge einer jahrelangen Anreicherung zu erhöhten Gehalten von Quecksilber kommen.
Gesundheitsrisiken für Menschen: Der Stoff ist giftig für das Nervensystem und kann in höheren Dosen auch Leber und Nieren schädigen. Methylquecksilber steht zudem in Verbindung mit Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System von Erwachsenen. Globale Gesundheitsauswirkungen der MeHg-Belastung für die Allgemeinbevölkerung werden auf 117 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt (Quelle: Environmental Letters 2024).
Diese Fischarten haben besonders hohe Quecksilber-Belastungen:
- Blaubarsch
- Hai (Schillerlocken)
- Königsmakrele
- Schwertfisch
- Thunfisch (Gelbflossenthun)
- Zackenbarsch
Quecksilber in Thunfisch
Thunfisch gehört weltweit zu den meistverzehrten Meeresfischen und weist gleichzeitig eine relativ hohe MeHg-Konzentration auf. Eine Studie aus dem Jahr 2024 untersuchte Quecksilberkonzentrationen in tropischen Thunfischen über die letzten 50 Jahre hinweg und kam zu dem Ergebnis, dass die Quecksilberbelastung seit den 1970er Jahren nicht zurückgegangen ist. Sie wird weiterhin durch Quecksilber-Altlasten gespeist.
Mikroplastik
Müll im Meer, vor allem in Form von Kunststoffen, ist allgegenwärtig und hartnäckig. Mikroplastik (0,0001-5 mm) wurde bereits in der gesamten Wassersäule (an der Wasseroberfläche, in Sedimenten und in Meeresorganismen) nachgewiesen.
Auch in Speisefisch sammelt sich Mikroplastik an: Einer Studie aus Portugal zufolge nehmen Konsumenten bis zu 842 Mikroplastikstückchen jährlich über Meeresfisch auf. Viele Fischarten aus Asien (sowohl Süßwasser als auch Meeresfisch) sind stark mit Mikroplastik belastet, ebenso viele Fischmehl-relevante Arten. Einer Studie aus England zufolge sind Muscheln, insbesondere aus Asien, am stärksten mit Mikroplastik belastet, gefolgt von Krebstieren, Fisch und Stachelhäutern.
Gesundheitsrisiken für Menschen: Bisher gibt es wenig Studien, was dieses Mikroplastik im Menschen anrichtet, die aber vermuten lassen, dass es Entzündungen im Gewebe auslöst und zu chronischen Erkrankungen führen kann.

Additive / Weichmacher
Auch chemische Kunststoffzusätze (Phthalate, Bisphenol A, Flammschutzmittel) können in die aquatische Umwelt gelangen, wo sie von Meeresbewohnern aufgenommen werden. Daher können sowohl adsorbierte als auch zugesetzte Chemikalien über den Verzehr von kontaminierten Meeresfrüchten und Fisch (frischer Fisch, ganze Fische, Fischkonserven und Trockenfisch) auf den Menschen übertragen werden.
Gesundheitsrisiken für Menschen: Zu den möglichen Auswirkungen des Verzehrs gehören Schädigungen der DNA und der Zellen sowie Entzündungsreaktionen (Quelle: Microplastic Pollution 2022).
PFAS / Ewigkeitschemikalien
Die Abkürzung PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Die chemischen Verbindungen sind wasser-, schmutz und fettabweisend, aber leider kaum abbaubar. Sie sind resistent gegen Hitze und UV-Strahlung. PFAS werden seit mehr als 60 Jahren in verschiedenen Produkten verwendet, z. B. in Feuerlöschschäumen, Imprägnierspray, Kochgeschirr, Funktionskleidung, Kosmetik oder Farben. Die Stoffe sind so mobil, dass sie über Regenwasser selbst in Tibet oder der Antarktis vorkommen.
Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nehmen Verbraucher*innen vor allem über Fisch- und Fleischerzeugnisse PFAS auf. Eine Studie aus dem Jahr 2022 untersuchte die Kontamination von sieben Fischarten und zwei Krebsarten in der südlichen Nordsee. In allen wurden Perfluoroctansulfonat (PFOS) gefunden und erhöhte Konzentrationen von Perfluorotridecansäure (PFTrDA) wurden in Fischlebern nachgewiesen.
PFAS sind giftig
PFAS sind hochpersistente Chemikalien mit toxikologischer Wirkung. Sie werden verdächtigt, Krebs zu verursachen, unfruchtbar zu machen und das Immunsystem zu schwächen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Mensch deutlich empfindlicher auf diese Substanzen reagiert als bisher angenommen. Damit gehören PFAS zu den Umweltkontaminanten in Lebensmitteln, von denen je nach aufgenommener Menge gesundheitliche Gefahren ausgehen können (Quelle: BMUV).
Sonderfall Muscheln: Sie filtern und filtern und … speichern
Die blauschwarzen Meeresbewohner sind in der Lage, bis zu drei Liter Umgebungswasser pro Stunde anzusaugen und organische Materie, Algen und sogar Schadstoffe herauszufiltern. Dabei selektieren sie nicht und die Schadstoffe reichern sich immer weiter in den Muscheln an.
Ihre Eigenschaft als natürlicher Wasserfilter wird beispielsweise in der Ostsee genutzt, wo Muschelzuchten genau dort eingesetzt werden, wo Abfallbeseitigung nicht richtig funktioniert und in denen man Düngemittel nicht reduzieren kann. Der Aspekt, dass am Ende Menschen Muscheln verzehren – ob direkt oder indirekt im Fisch, der mit Muschelmehl gefüttert wurde – wird dabei zu wenig berücksichtigt. Alle 28 essbaren Muschelarten können Schadstoffe enthalten.
Gefährliche Viren und Algentoxine
Muschelfarmen befinden sich oft in Küstennähe. Ihre Bestände sind durch Verunreinigungen mit menschlichen Fäkalien gefährdet, die aus Abwässern von Kläranlagen, Regenüberläufen, Klärgruben oder Booten stammen. Viren überleben im Meer mehrere Tage und werden bis zu 10 km weit transportiert. Die Kontamination von Muscheln mit Krankheitserregern wie dem Norovirus (NoV) ist eine anerkannte Gefahr für die menschliche Gesundheit – besonders der Verzehr von kontaminierten rohen Schalentieren (z. B. Austern) stellt ein Risiko dar, weswegen der Austernverkauf aus manchen Regionen Frankreichs Ende 2023 verboten wurde.
Wie kommt es zur Muschelvergiftung?
Muscheln können in den warmen Monaten durch Algengifte belastet sein. Diese Gifte reichern sich mitunter während der Algenblüte im Sommer in den Muscheln an. Wer selber Muscheln sammelt, sollte das berücksichtigen. Nach dem Verzehr der Muscheln können Durchfallerkrankungen oder sogar Lähmungserscheinungen auftreten. Man spricht dann von Muschelvergiftungen, obwohl es sich eigentlich um Algenvergiftungen handelt.
Listerien und Parasiten
Listerien in Lachserzeugnissen
Insbesondere bei geräucherten und gebeizten rohen Fischprodukten wie Räucherlachs, Stremel Lachs sowie Graved Lachs wurden häufige Überschreitungen bei der Keimbelastung mit Listeria monocytogenes festgestellt. Grund hierfür ist hauptsächlich mangelnde Hygiene in den verarbeitenden Betrieben. Der Verzehr von belasteten Nahrungsmitteln kann zu einer Listeriose-Erkrankung führen, diese kann einen schweren Verlauf nehmen und schlimmstenfalls tödlich enden. Es kann zu Blutvergiftungen, Hirnhautentzündungen und bei Schwangeren zu Fehlgeburten kommen.
Parasiten in Fisch
Alle Seefische können natürlicherweise von Parasiten befallen sein. Weit verbreitet sind zum Beispiel Nematoden (Rundwürmer), die Fische mit der Nahrung aufnehmen. Sie besiedeln vor allem den Magen-Darm-Trakt und die Bauchlappen der Fische. Immer wieder werden in Seefischen Nematoden nachgewiesen, so zum Beispiel 2021 in den Lachs-Tests von Stiftung Warentest und Öko-Test. Beim Menschen können sie Bauchkrämpfe, Übelkeit und Erbrechen verursachen, jedoch werden sie durch Tiefgefrieren und Hitze abgetötet.
Antibiotika-Einsatz in der Aquakultur
Wie auch bei anderen Formen der Massentierhaltung werden in der Fischzucht Antibiotika und andere Medikamente eingesetzt. Während in Europa und Nordamerika der Einsatz von Antibiotika in der Aquakultur streng geregelt ist, ist der Einsatz von Antibiotika wie Oxytetracyclin, Florfenicol und Trimethoprim/Sulfadiazin in vielen Entwicklungsländern – wo der Großteil der in Europa verzehrten Garnelen, Thunfische oder Kabeljau herkommen – Standard.
Fischmehl: Antibiotikaresistenzgene (ARG) sind in den Sedimenten der Marikultur weltweit verbreitet. Eine wichtige Quelle hierfür ist Fischmehl. Das in der Aquakultur als Futter eingesetzte Fischmehl enthält Antibiotika-Rückstände und bakterielle Resistenzgene (Quelle: Scinexx.de).
Gesundheitsrisiken für Menschen: Antibiotikaresistenzen sind ein zunehmendes Problem auch in der Humanmedizin. Eine Ausbreitung resistenter Bakterien in der Umwelt kann dieses weiter verschärfen.
Überfischung, Artensterben, tierethische Bedenken oder Beifang: Es gibt gute Gründe, auf den Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten zu verzichten. Vor allem, wenn dank der Verschmutzung Fisch gar nicht so gesund ist, wie gerne behauptet wird. Was können wir tun, um unseren Bedarf an wertvollen Nährstoffen aus Fisch zu decken und gleichzeitig die Ökosysteme der Meere zu schonen?
Die Nährstoffe, die Fisch so empfehlenswert machen, können wir größtenteils mit einer rein pflanzlichen Ernährung aufnehmen. Bei der Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren spielen Mikroalgen und Algenöl eine Rolle, genauso wie Lein-, Raps-, Hanf- und Walnussöl. Jod liefern Algen (Seetang, Nori, Wakame) und in geringem Maße auch Gemüsearten wie Brokkoli, Spinat oder Feldsalat. Eine gute Eiweißquelle bieten zum Beispiel Linsen, Sojaflocken, Erdnüsse oder Hanfsamen.